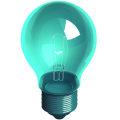Der X-Faktor bei Goldesel
Was haben Fake News, Elon Musk und ein deutscher Rüstungskonzern gemeinsam? Sie alle spielten eine Rolle in dieser Woche, die die Märkte in Aufruhr versetze. Hier für euch das Wichtigste zusammengefasst!
Der “Schwarze Montag”
Nachdem die USA Ende letzter Woche (ihr habt es schon gelesen) pauschale Importzölle von 10 Prozent verhangen haben – mit deutlich höheren Sätzen für einzelne Handelspartner, darunter 34 Prozent für China und 25 Prozent für Kanada und Mexiko – fragen sich viele nach dem „Warum?“. Ziel war es laut Trump, die „wirtschaftliche Unabhängigkeit Amerikas“ zu sichern.
Die Finanzmärkte reagierten schockartig am vergangenen Montag: US-Aktien brachen ein, besonders stark bei global agierenden Konzernen wie Apple, Tesla oder Nvidia. Der Dow Jones verlor innerhalb von zwei Tagen rund 4.000 Punkte, asiatische und europäische Börsen folgten mit deutlichen Verlusten. Analysten warnten vor einem möglichen Handelskrieg, einer daraus resultierenden Rezession und dem Vertrauensverlust in den Partner USA.
Trumps Regierung bezeichnete die Maßnahmen als „notwendige Medizin“, doch aus ökonomischer Sicht war es ein klassischer Vertrauensschock: Investoren flüchteten aus Risikoanlagen, Margin Calls brachten selbst langweilige Dividendentitel zu Fall und die Unsicherheit über die künftige Weltwirtschaftsordnung erreichte ein neues Hoch.
Am Mittwoch dann zunächst leichte Erleichterung an den Märkten, nachdem Trump seine in der Vorwoche verhängten Zölle gegen etliche Staaten für eine Dauer von 90 Tagen teilweise ausgesetzt hat. Die Erholung wurde einen Tag später aber wieder abverkauft, das Wort “Bullenfalle” machte die Runde.

Nur die gegen China verhängten Zölle wurden auf 125 Prozent angehoben. Peking hatte zuvor mit Gegenzöllen in Höhe von 84 Prozent auf Importe aus den USA reagiert.
Aber auch Europa scheint sich nicht zum Spielball der Zoll-Eskapaden Trumps machen zu wollen:

Gibt es einen großen Plan und wenn ja, wie viele?!
Dass sich zunehmend die Frage stellt, ob hinter Trumps wirtschaftspolitischem Handeln – insbesondere seiner aggressiven Zoll- und Außenhandelspolitik – ein übergeordneter Plan steckt, ist Ausdruck wachsender Unsicherheit in Politik und Wirtschaft. Denn auf den ersten Blick wirkt vieles erratisch, impulsiv, ja sogar konfrontativ inszeniert. Doch bei genauerem Hinsehen lassen sich vielleicht strategische Motive erkennen. Einerseits muss der Präsident natürlich seine Wähler zufriedenstellen, besonders in Regionen, die von der Globalisierung wirtschaftlich abgehängt wurden.
- Dazu könnte eine mögliche Erklärung passen: der Versuch, die “Deindustrialisierung” der Vereinigten Staaten umzukehren – also die schleichende Verlagerung industrieller Wertschöpfung ins Ausland, die seit den 1990er-Jahren große Teile der klassischen US-Industrie erfasst hat. Die politischen Zölle sollen gezielt Produktionskosten für ausländische Anbieter erhöhen und so einen Anreiz schaffen, Fertigung zurück in die USA zu holen. Trumps Team kalkuliert offenbar mit einer Art “Renaissance der Industrie”: Arbeitsplätze in traditionellen Sektoren wie Maschinenbau, Stahl, Automobil oder Chemie sollen zurückkehren, mit dem Ziel, wirtschaftlich abgehängte Regionen im Mittleren Westen und Rust Belt zu revitalisieren – dort, wo sich ein Großteil seiner Wählerbasis befindet.
- Eine andere Möglichkeit, die auch von einigen Medien favorisiert wird: Das sogenannte „Mar-a-Lago-Abkommen“, eine Idee aus dem Umfeld der US-Regierung. Es knüpft an historische Währungsabkommen wie Bretton Woods oder das Plaza-Abkommen an, verfolgt aber einen unkonventionellen Ansatz: Länder, die vom US-Militärschutz profitieren, sollen demnach ihre Dollarreserven in langfristige US-Staatsanleihen umschichten, um den Dollar zu schwächen und so die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft zu stärken. Stephen Miran, Harvard-Absolvent und Wirtschaftsberater von Trump, verfasste dazu eine 41 Seiten lange These, in der er kritisiert, dass die USA zwei wesentliche Güter der Welt zur Verfügung stellen: militärischen Schutz und den Dollar als globale Reservewährung. Im Gegenzug stellt er sich vor, dass die anderen Länder erhöhte Zölle ausnahmslos annehmen sollten – als eine Art moderne Tributzahlung (kurz zusammengefasst!). Unter Ökonomen ist diese Idee sehr umstritten.

- Oder ganz einfach: Schon während seiner ersten Amtszeit kritisierte Trump die Fed offen und aggressiv – insbesondere deren damalige Zinserhöhungen. Mit massiven Zollerhöhungen provoziert Trump gezielt wirtschaftliche Verwerfungen: höhere Importpreise, sinkende Unternehmensgewinne, Investitionszurückhaltung. Die Folge: eine wirtschaftliche Abkühlung, die die Fed in Zugzwang bringt, um gegenzusteuern – klassischerweise mit Zinssenkungen.
Sollte wirklich ein „Re-Industrialisierungsgedanke“ der Auslöser für Trumps Wirtschaftspolitik sein, wäre das eine klare Kampfansage an die Globalisierung, wie sie die USA jahrzehntelang selbst mitgestaltet haben und die unseren Wohlstand garantiert hat. Da die USA aber inzwischen eine Konsumgesellschaft sind und die Industrie sich mehr auf Technologie spezialisiert hat, werden die benötigten und nachgefragten Güter in den USA niemals oder zumindest nicht in naher Zukunft so günstig wie im Ausland produziert werden können:

Was sagt Elon Musk zu den Zöllen?
Trotz des Aufruhrs an den Börsen hält US-Präsident Trump an seiner Zollpolitik fest, auch wenn nun eine 90tägie Pause zum Verhandeln eingelegt wurde.
Sein Berater Musk schlägt währenddessen ganz andere Töne an – und fordert eine “Null-Zoll-Situation” zwischen Europa und den USA. Denn Musk bleibt eines in erster Linie: Unternehmer.
Im Zollstreit hat er sich für eine transatlantische Freihandelszone ohne jegliche Zölle ausgesprochen. Er hoffe, dass sich die USA und Europa auf eine noch engere Partnerschaft als bisher einigen könnten, sagte der per Video zugeschaltete Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla bei einem Parteitag der rechten italienischen Partei Lega.

Und nicht nur das, er teilte zu Beginn der Woche das Video von Milton Friedman aus dem Jahr 1980:

Darin erklärt der US-Ökonom, dass man auch für ein so „einfaches“ Produkt wie einen Bleistift bereits Bestandteile aus der ganzen Welt benötigt. Und dass deshalb der „freie Markt“ und die Einheit zwischen den Handelspartnern weltweit so wichtig ist – ein ungeschriebenes Gesetz, das Trump nun gebrochen hat. Sehenswertes Video!
Der noch geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wertet die unmittelbar nach Trumps Zollankündigungen laut gewordenen Forderungen nach einer transatlantischen Freihandelszone von Musk mutig als Ausdruck politischer Verunsicherung.
Die Äußerungen von Musk, der sich offen für Freihandel zwischen Europa und den USA zeigte, könnten laut Habeck durch die Sorge motiviert sein, dass Trumps Zollpolitik seinen Unternehmen – etwa Tesla oder SpaceX – empfindlichen wirtschaftlichen Schaden zufügen könnte.

Fake News bewegen die Märkte
Am Montag kamen plötzlich auf X Gerüchte auf, die sich erst am Mittwoch bewahrheiten sollten: nämlich, dass die Zölle für 90 Tage pausieren würden. Wie unter anderem auch der Focus berichtet, haben verschiedene Finanz-Accounts (die beiden gleich zitierten haben zusammen mehr als eine Millionen Follower) dem Gerücht Glauben geschenkt, welches es sogar ins Fernsehen bei CNBC schaffte. Dies führte zu einem kurzfristigen Anstieg des S&P 500 Index um fast 6 Prozent. Als sich die Information als falsch erwies, fielen die Aktienkurse wieder auf ihr vorheriges Niveau zurück. Sowohl CNBC als auch die Nachrichtenagentur Reuters, die die Meldung übernommen hatte, mussten ihre Berichterstattung korrigieren und bedauerten den Fehler.

So oder so: aktuell wird massiv Vertrauen in die USA und das Wirtschaftssystem zerstört. Und wenn sich Falschinformationen – gerade mit Bezug auf so einflussreiche Themen wie Zölle oder Aussagen des US-Präsidenten – so schnell verbreiten und sogar von großen Medien wie CNBC oder Reuters ungeprüft übernommen werden, leidet das Vertrauen massiv. Für Anleger, besonders Daytrader oder News-Trader, kann so etwas gravierende Folgen haben – von Fehleinschätzungen bis hin zu finanziellen Verlusten. Und der Markt wird anfälliger für Manipulationen. Apropos:

Zeit für Insiderkäufe
Viele Insider kauften bei uns in Deutschland ebenfalls Aktien und nutzen die Kursstürze diese Woche – allerdings höchst offiziell! Direkt am Montag schlug zum Beispiel der CEO von Rheinmetall, Armin Papperger, zu: er kaufte über eine Holding und selbst für knapp 700.000 Euro Aktien zum Preis von 1.058 Euro bzw. 1.065 Euro. Aktuell steht die Aktie bei 1.350 Euro – kein schlechter Zeitpunkt!

Weitere Insiderkäufe gab es unter anderem bei LEG Immobilien, Energiekontor, Munich Re, init – innovation in traffic und vielen mehr.
Auch die X-Community kaufte bereits Aktien in die Schwäche hinein ein, wie zum Beispiel:

Viele Anleger lassen auch einfach ihre Sparpläne weiter laufen und freuen sich über günstigere Kurse. Wie lange die Kurskapriolen weitergehen werden oder ob wir bereits in einem Bärenmarkt sind, ob wirklich ein großer Plan zum Wandel des globalen Handelssystems dahinter steckt – das weiß allerdings aktuell niemand.
Vielen Dank für’s Lesen! Wir sehen uns entweder nächste Woche hier oder auf X – eure Lara / eure @peppershares
Weitere spannende Themen