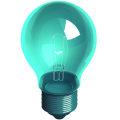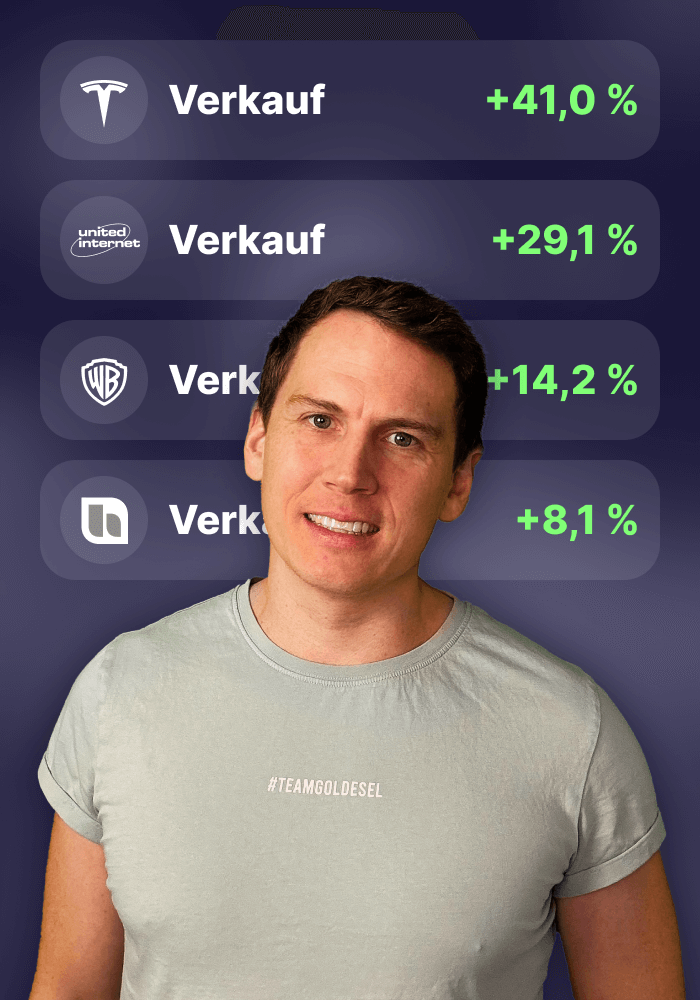Averaging down ohne Plan: Wann Nachkaufen sinnvoll ist – und wann gefährlich
„Billiger geworden? Dann nachkaufen.“ – dieser Reflex ist verbreitet. Averaging down (den Durchschnittskaufpreis durch Zukäufe im Kursrückgang senken) kann funktionieren, wenn die Regeln stimmen. Ohne Plan erhöht es das Risiko, konzentriert das Depot und verlängert Drawdowns. Dieser Leitfaden erklärt präzise, wann Nachkaufen sinnvoll ist, wann es brandgefährlich wird – und liefert ein Regelwerk mit Rechenhilfen, Checklisten und einer Entscheidungs-Matrix.
Was bedeutet Averaging down
Kurz erklärt: Nach Kursverlusten werden weitere Stücke gekauft, um den Durchschnittspreis zu senken.
Formel (einfach): Durchschnittspreis = (Stückzahl1 * Preis1 + Stückzahl2 * Preis2 + ...) / (Stückzahl1 + Stückzahl2 + ...)
Beispiel:
Stückzahl1 = 10, Preis1 = 100
Stückzahl2 = 10, Preis2 = 70
Invest gesamt = 10*100 + 10*70 = 1700
Stücke gesamt = 20
Durchschnittspreis = 1700 / 20 = 85
Wichtig: Der Breakeven sinkt, die Positionsgröße und damit das Risiko steigen.
Nicht verwechseln: Averaging down, DCA und Rebalancing
- Averaging down: kursgesteuerter Nachkauf in einer Position nach Rückgang.
- DCA (Sparplan): zeitgesteuerte Käufe in fixen Abständen – unabhängig vom Kurs.
- Rebalancing: Depot regelbasiert auf Zielquoten zurückführen (z. B. Aktien/Anleihen); kauft antizyklisch breite Segmente, nicht einzelne „Problemfälle“.
Merksatz: Wer Marktbreite nachkaufen will, nutzt Rebalancing – nicht Averaging down auf Einzelwerte.
Wann nachkaufen sinnvoll sein kann
Averaging down ist kein Standardwerkzeug. Sinnvoll nur, wenn mehrere Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:
- These intakt, Preis gefallen Geschäftsmodell, Bilanz, Wettbewerbsvorteil und Ausblick sind ungebrochen; der Rückgang ist überwiegend Marktlärm (Sektor-Abverkauf, Sentiment), kein Thesenbruch.
- Diversifiziertes Vehikel Breit gestreute ETFs/Indizes eignen sich eher für antizyklische Zukäufe als Einzeltitel, weil das Ausfallrisiko niedriger ist. Rebalancing ist hier die solide Variante.
- Risikobudget & Positionslimits Vorab definieren: max. Positionsgröße (z. B. 5 % je Einzeltitel, 20 % je Thema) und Risikobudget pro Position (z. B. 1–2 % Depotwert als tolerierter Beitrag zum Gesamtdrawdown).
- Zeit & Liquidität Genügend Zeithorizont und Liquiditätsreserve (3–6 Monatsausgaben), um nicht in schwachen Phasen verkaufen zu müssen.
- Staffelung statt Vollgas Nachkauf in Tranchen (z. B. −10 % / −20 % / −30 % unter Erstkauf) mit klarer Obergrenze; zwischen den Tranchen eine Abkühlzeit (mindestens eine Nacht).
Wann nachkaufen brandgefährlich wird
Hier sollte Averaging down unterbleiben – oder die Position eher abgebaut werden:
- Thesenbruch Strukturelle Änderungen: Margen-/Umsatzkollaps, Bilanzprobleme, Verwässerung, Verlust des Wettbewerbsvorteils.
- Value Trap statt Schnäppchen Der Kurs fällt, weil die Ertragsbasis erodiert – nicht, weil „alle übertreiben“.
- Klumpenrisiko Die Position dominiert das Depot. Nachkauf verschärft die Konzentration.
- Leverage/Margin Nachkauf auf Kredit erhöht das Liquidationsrisiko.
- Negatives Momentum ohne Gegensignal Anhaltender Abwärtstrend ohne fundamentale Stabilisierung – blinde Dip-Käufe sind riskant.
- Mythos „die meisten erholen sich“ Langfristige Aktienrenditen sind schief verteilt: Wenige Gewinner treiben den Markt, viele Titel bleiben zurück. Nachkauf ins falsche Pferd zementiert Unterperformance.
Entscheidungs-Matrix (Schnellcheck)
| Kriterium | Nachkauf möglich | Finger weg |
| These | Intakt | Gebrochen |
| Vehikel | Breiter ETF/Index | Zyklischer, hochverschuldeter Einzeltitel |
| Risiko | Limit frei, Budget vorhanden | Limit erreicht, Klumpenrisiko |
| Trend | Stabilisierung/Range | Starkes Abwärtsmomentum |
| Finanzplan | Reserve vorhanden | Margin/Cash-Zwang |
| Umsetzung | Tranchen + Obergrenze | All-in/„Verdoppeln bis Null“ |
Praxiswege zum Nachkauf
A) Rebalancing-Nachkauf (für ETF/Assetklassen)
- Regel: Wenn Aktienquote < Ziel – 5 PP ⇒ stufenweise auffüllen.
- Vorteil: Antizyklisch, diszipliniert, diversifiziert.
- Setup: Kalenderbasiert (z. B. jährlich/halbjährlich) oder Schwellen-basiert (Bandbreiten).
B) These-basiertes Averaging (für Einzeltitel)
- Vorab-Check:
- These schriftlich prüfen (Katalysatoren, Bilanz, Wettbewerb, Guidance).
- Warum ist es günstiger? Markt, Sektor oder Firma?
- Passt der Zukauf ins Positionslimit und Risikobudget?
- Umsetzung: 2–3 Tranchen; Max-Gewicht strikt einhalten.
- Abbruch: Sofort stoppen bei Thesenbruch.
C) Sparplan temporär erhöhen (für Einsteiger)
- ETF-Sparrate in Schwächephasen moderat anheben (z. B. +20–30 %), danach zurücksetzen.
- Erhöht Engagement ohne Klumpenrisiko auf einzelne Namen.
Mehr spannender Goldesel Content
- Berkshire Hathaway Aktie: Prognose 2025 – Buffett tritt ab, lohnt der Einstieg?
- Amazon als Starlink-Konkurrent & weiterer ASML-Anstieg?
- FED vor nächster Zinssenkung: Crash-Gefahr oder Rallye?
- Kaufkandidaten von Michael & Daniel, Klarna IPO & Zahlen bei Adobe
- Goldesel Langfristdepot: Unser Kauf im August
Positionsgröße pragmatisch bestimmen
Ziel: Verluste begrenzen, bevor sie dominieren.
- Risikobudget pro Position: z. B. 1 % des Depotwerts als „Akzeptanz-Beitrag“ zum Gesamtdrawdown.
- Faustformel: Positionsobergrenze ≈ Risikobudget ÷ erwartete Max-Schwankung. Beispiel: 1 % Budget, 20 % Schwankung ⇒ 5 % Max-Gewicht.
- Konsequenz: Wenn bereits 5 % erreicht sind, kein Averaging down – oder nur durch Umschichtung innerhalb des Themas.
Mini-Rechenblock: Breakeven nach Nachkauf
Start: n₀ zu P₀, danach n₁ zu P₁.
Gesamtinvest: I = n₀ × P₀ + n₁ × P₁
Stückzahl: N = n₀ + n₁
Breakeven-Preis: P_BE = I / N = P_avg
Merke: Jeder Nachkauf erhöht I. Fällt der Kurs weiter, wächst der absolute Verlust schneller – deshalb sind Tranchen und Obergrenzen entscheidend.
FOMO-Filter & Exit-Regeln
FOMO-Selbstcheck (30 Sek.)
Zwei-mal „Ja“ ⇒ FOMO-Alarm:
- Positionsgröße spontan höher als üblich?
- Kursziel recherchiert, aber Risiken nicht?
- Unruhe, wenn der Kauf heute nicht passiert?
- Kein klar formulierter Ausstiegsgrund?
Klare Verkaufsregeln (ohne Hektik)
Verkauft wird bei Thesenbruch, Risikolimit verletzt, besserer Alternative oder Liquiditätsbedarf – nicht nur, weil der Kurs gefallen ist.
Kurz-Protokoll für jeden Exit: Welche Annahme ist gebrochen? Welche Regel greift? Wohin mit dem Erlös?
Mehr zum Thema FOMO & Panikverkäufe
FOMO & Panikverkäufe: Die teuersten Anlegerfehler – stoppen mit System
Was niemals in den Nachkauf-Plan gehört
- Kein „Verdoppeln bis Null“
- Kein Nachkauf aus der Notreserve
- Keine Margin-„Rettungskäufe“
- Keine Illiquidität (dünne Spreads + Volatilität = teure Fehler)
Entscheidungs-Checkliste (vor jedem Nachkauf)
- These ok? (max. 5 Sätze)
- Limit frei? (Positionsgröße innerhalb Obergrenze)
- Budget klar? (keine Notreserve, kein Kredit)
- Vehikel passend? (ETF statt Einzeltitel, wenn Marktbreite gewünscht)
- Umsetzung in Tranchen (mit Abkühlzeit)
- Exit-Grund definiert (These-Bruch, Limit, Rebalancing)
- Depot-Logbuch (Datum, Grund, Regel)
Fazit
Averaging down ist ein Werkzeug, kein Automatismus. Sinnvoll ist es nur bei intakter These, freiem Risikobudget und passenden Vehikeln – idealerweise mit Rebalancing-Logik. Brandgefährlich wird es bei Thesenbruch, Klumpenrisiko, Leverage und blindem Dip-Kauf. Wer nach festen Regeln in Tranchen handelt, Positionsgrößen diszipliniert steuert und Exit-Kriterien vorher festlegt, behält Kontrolle – und schützt Rendite, Nerven und Ziele.
Weitere spannende Themen